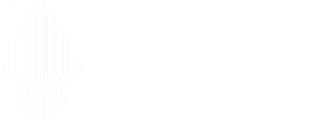- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- Mannheim (Jesuitenkirche)
- Mannheim (Jesuitenkirche, Chororgel)
- Maria Luggau (Wallfahrtskirche)
- Meggen (St. Bartholomäus)
- Mellweg (St. Gertraud)
- Mudersbach (Maria Himmelfahrt)
- Mudersbach (ehem. Hausorgel Hiller)
- München (Deutsches Museum, Steinmeyer)
- München (Deutsches Museum, Ahrend)
- Münster (St. Lamberti)
- Münster (Petrikirche)
- Münster (Erlöserkirche)
- Müsen (ev. Kirche)
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- Weitere
- Zugabe
Münster, Petrikirche
Orgel von Franz Breil (Dorsten), 1962.

Die 1598 geweihte Petrikirche war ehemals – bis zur Auflösung des Ordens 1773 – Kirche des Münsterschen Jesuitenkollegs. Nach erheblicher Kriegszerstörung 1943 wurde sie nach alten Plänen wieder aufgebaut und ist seit 1957 Schulkirche des Gymnasium Paulinum und Heimat der katholischen Studierenden- und Hochschulgemeinde (KSHG).
Ihre erste Orgel erhielt die Jesuitenkirche rund drei Jahrzehnte nach ihrer Fertigstellung 1625/27: ein Werk des jungen Orgelbauers Arnold Bader, der sich kurz zuvor in Münster niedergelassen hatte. Das mit 18 Registern üppig besetzte Werk hatte 300 Rthl. gekostet.
Nach Auflösung des Jesuitenordens baute Melchior Vorenweg 1792/93 eine neue Orgel. Mit 12 Registern war das Instrument zwar vom Umfang kleiner als die Vorgängerorgel, aber die geteilte Aufstellung zu beiden Seiten des großes Westfensters mit einem Trakturkanal im Emporenfußboden galt damals als eine Besonderheit. Drei Register aus der alten Orgel wurden übernommen.
Durch die wechselnden Besitzverhältnisse zu Beginn des 19. Jahrhunderts und die zwischenzeitliche Benutzung als Kriegsmagazin war die Orgel sehr in Mitleidenschaft gezogen worden und musste daher 1809 durch Vorenweg wiederhergestellt werden.
1905 lieferte die Münsteraner Orgelbauanstalt Friedrich Fleiter eine neue pneumatische Orgel mit 18 Registern, die in das historische Gehäuse von 1792/93 eingebaut wurde. Beides – Gehäuse und Orgelwerk – fielen den Bomben des Zweiten Weltkriegs 1943 zum Opfer.
Nach dem Krieg baute Franz Breil (Dorsten) 1962 nach den Plänen des Orgelsachverständigen Rudolf Reuter eine neue Orgel, die die zweigeteilte Anlage zu beiden Seiten des Westfensters wieder aufgriff – allerdings in der wesentlich schlichteren Formensprache der Zeit. Auf der linken Seite steht das Hauptwerk mit der ins Untergehäuse integrierten Spielanlage; im Rücken des Spielers steht das Rückpositiv, dessen Gehäuse allerdings nicht in die Emporenbrüstung integriert ist – dazwischen sind noch rund anderthalb Meter Platz. Rechts neben dem Fenster steht das Pedalwerk, dessen Gehäusegestaltung ein Spiegelbild zum Hauptwerksgehäuse ist.
1993 führte Matthias Kreienbrink (Osnabrück) eine Generalüberholung durch, bei der aber keine Eingriffe ins Klangbild erfolgten.
I. RÜCKPOSITIV | C–g³
Gedackt 8'
Prinzipal 4'
Rohrflöte 4'
Gemshorn 2'
Terz 1 3/5'
Quinte 1 1/3'
Scharff 5fach 1'
Schalmei 8'
Tremulant R.P.
II. HAUPTWERK | C–g³
Prinzipal 8'
Spitzflöte 8'
Oktave 4'
Gedacktflöte 4'
Oktave 2'
Sesquialtera 2fach
Mixtur 8fach 1 1/3'
Dulzian 16'
Trompete 8'
Tremulant H.W.
Koppel I–II
PEDAL | C–f¹
Subbass 16'
Prinzipal 8'
Oktave 4'
Pommer 4'
Nachthorn 2'
Mixtur 5fach 2 2/3'
Posaune 16'
Trompete 8'
Pedalkoppel II [Ist I]
Pedalkoppel I [ist II]
Mechanische Schleiflade.
D-48143 Münster | Jesuitengang
Quellen und Literatur: Rudolf Reuter, Orgeln in Westfalen, Kassel u. a. 1965, S. 275 f ⋄ Münstersches Orgelmagazin (ehemalige Seite unter www.orgelmagazin.de) ⋄ Werkliste Orgelbau Fleiter ⋄ Eigener Befund.
Nr. 50 | Diese Orgel habe ich am 13.06.1999 im Rahmen eines Gottesdienstes gespielt.
© Dr. Gabriel Isenberg | Letzte Änderung: 02.05.2023.
www.orgelsammlung.de
© Dr. Gabriel Isenberg, 2023