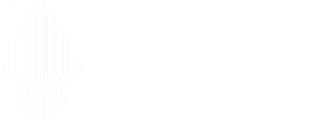- A
- B
- C
- D
- Dahlbruch (St. Augustinus)
- Damme (St. Viktor)
- Damme (St. Benedikt)
- Damme (Hausorgel Riedesel/Isenberg)
- Dattenfeld (St. Laurentius)
- Dellach (St. Nikolaus)
- Delmenhorst (Allerheiligen)
- Deutz (St.-Johannes-Kirche)
- Diepholz (St. Nicolai)
- Dillenburg (Stadtkirche)
- Dinslaken (St. Vincentius)
- Dreis-Tiefenbach (Namen Jesu)
- Drolshagen (St. Clemens, Basilika)
- Drolshagen (St. Clemens, neue Kirche, ehem. Orgel)
- Düffelward (St. Mauritius)
- Dumicke (St. Elisabeth, ehem.)
- Dumicke (St. Elisabeth)
- Dwergte (Marienkapelle)
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- Weitere
- Zugabe
Deutz, St.-Johannes-Kirche
Orgel von Willi Peter (Köln-Mülheim), 1963.

Die evangelische St.-Johannes-Kirche im rechtsrheinischen Kölner Stadtteil Deutz wurde 1859–61 nach den Plänen von Eduard Kramer erbaut und nach Kriegszerstörung bis 1952 wiederhergestellt. In der Innenraumgestaltung fällt die in S-Form geschwungene Empore mit dem Posaunenengel aus Kupferblech an der Rückwand ins Auge.
Am 20. Oktober 1865 fand die Weihe der ersten Orgel statt, erbaut von der Orgelbauwerkstatt der Gebr. Weil in Neuwied mit 16 Registern auf zwei Manualen und Pedal. Durch Paul Faust (Schwelm) erfolgte 1911/12 ein Umbau, 1921 lieferte der Orgelbauer Heinrich Söhl neue Prospektpfeifen (als Ersatz für die im Krieg abgelieferten Zinnpfeifen). Pläne zum Umbau und zur Modernisierung der Orgel von Faust (1928) und Sauer (1937) kamen nicht zur Ausführung.
In der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 1942 fiel die Orgel einem Brandbombenangriff zum Opfer. Nachdem 1952 die neue Empore eingezogen war, dauerte es noch über zehn Jahre, bis schließlich 1963 die neue Orgel aus der Orgelbauwerkstatt Willi Peter (Köln-Mülheim) eingeweiht werden konnte. Den skulpturartigen Gehäuseprospekt mit den drei harfenförmig übereinandergetürmten Baukörpern entwarf Dr. Walter Supper. Zuunterst ist das Schwellwerk mit Plexiglas-Jalousien aufgestellt, darüber befindet sich das Hauptwerk, bekrönt vom Pedalwerk.
Um die Traktur in den eigenwilligen Gehäuseformen gut verlegen zu können, fertigte Peter diese aus Nylonseilen, so dass eine flexible Führung möglich war. Die Registertraktur ist elektrisch angelegt und durch drei geteilte Setzer als Spielhilfe unterstützt. Die vielfarbige Intonation nahm Willi Schmidt vor. Die sich aus Disposition und Intonation ergebende große stilistische Vielfalt der Orgel zeigt allein das Einweihungsprogramm, bei dem Werke von Pachelbel, Bach, Distler, Händel und Duruflé gespielt wurden.
Witterungsbedingte Probleme mit der Nylonseil-Traktur machten um die Jahrtausendwende eine größere Renovierung notwendig, die die Fa. Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstätten im Dezember 2001 ausführte.
Im frontal eingebauten Spielschrank befinden sich die Registerwippen an der linken Seite. Die sehr frühe Form des frei programmierbaren, dreifachen Setzers wird über die Generalschalter I bis III unter dem Untermanual bedient; zum Speichern muss die S-Taste gedrückt gehalten werden. Die Taste A ist der Auslöser. Die programmierten Setzer können aber auch für die Werke getrennt eingeschaltet werden; dazu befinden sich in den linken Klaviaturbacken jeweils drei Metallknöpfe I bis III sowie drei Fußtritte I bis III. Die drei Koppeln sind als mit den Wippen korrespondierende Fußtritte eingerichtet. An der linken Spielschrankseite befinden sich zwei Drehschalter zur Geschwindigkeitsregulierung der beiden Tremulanten.
I. HAUPTWERK | C–g³
Pommer 16’
Prinzipal 8’
Gedeckt 8’
Oktave 4’
Blockflöte 4’
Nasat 2 2/3’
Waldflöte 2’
Terz 1 3/5’
Jauchzend Pfeife 1’
Mixtur 5–6f. 2’
Trompete 8’
Tremulant HW
Koppel II–I
II. SCHWELLWERK | C–g³
Rohrflöte 8’
Spitzgambe 8’
Prinzipal 4’
Singend Nachthorn 4’
Oktave 2’
Überbl. Gemsquinte 1 1/3’
None 8/9’
Scharff 4f. 1 1/3’
Schalmey 8’
Tremulant SW
PEDAL | C–f¹
Subbaß 16’
Oktavbaß 8’
Gemsflöte 8’
Rohrpommer 4’
Nachthorn 2’
Hintersatz 4f. 4’
Posaune 16’
Koppel II–P
Koppel I–P
Drei Setzer (I bis III) als Generalsetzer oder Einzelwerkschaltung.
Geschwindigkeitsregler für die Tremulanten.
Schleiflade, mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur.
D-50679 Köln | Tempelstraße 31
Quellen und Literatur: Franz-Josef Vogt, Zerstört und vergessen: Von unbekannten Kölner Orgeln, in: Acta Organologica 30, Kassel 2008, S. 289–312, hier S. 303–305 ⋄ Beschreibung auf der ehem. Internetseite der Kirchenmusik Deutz/Poll ⋄ Eigener Befund.
Nr. 321 | Diese Orgel habe ich am 11.07.2009 im Rahmen eines Gottesdienstes gespielt.
© Dr. Gabriel Isenberg | Letzte Änderung: 09.07.2023.
www.orgelsammlung.de
© Dr. Gabriel Isenberg, 2023