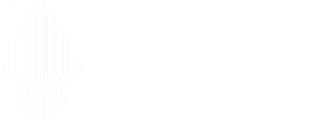- A
- B
- Bad Berleburg (ev. Stadtkirche)
- Bad Ems (ev. Martinskirche)
- Bad Laasphe (St. Petrus und Anna)
- Bad Zwischenahn (St. Marien)
- Barrien (St. Bartholomäus)
- Bayreuth-St. Georgen (Ordenskirche)
- Beek (Herv. Kerk)
- Beilstein (Schlosskirche)
- Bendigo (Sacred Heart Cathedral)
- Berghausen (ev. Kirche)
- Bickendorf (St. Rochus)
- Biedenkopf (große Hausorgel Schneider)
- Biedenkopf (kleine Hausorgel Schneider)
- Biedenkopf (Regal-Hausorgel Schneider)
- Bilstein (St. Agatha)
- Bimmen (St. Martin)
- Birnau (Wallfahrtskirche)
- Blankenstein (St. Johannes Bapt.)
- Bookholzberg (St. Bernhard)
- Bottenberg (Hausorgel Fischbach)
- Bottrop (Herz Jesu)
- Bottrop-Boy (Paul-Gerhardt-Kirche)
- Boxtel (St. Petrus)
- Brachbach (St. Josef)
- Braunfels (St. Anna)
- Breda (Franciscuskerk)
- Bredeney (Villa Hügel)
- Bremen (ULF)
- Bremen (St. Pauli)
- Bremen (HfK, Raum 2.34)
- Bremen-Schwachhausen (St. Ansgarii)
- Bremen-Schwachhausen (St. Remberti)
- Brezzo di Bédero (San Vittore)
- Broich (Herz Jesu)
- Bruchhof-Sanddorf (Hausorgel Weyers)
- Bruchsal (Hofkirche)
- Buchenbach (St. Blasius)
- Bümmerstede (St. Josef)
- Burbach (Hl. Kreuz)
- Burgsolms (St. Elisabeth)
- Burhave (Herz Mariä)
- Buschhütten (ev. Kirche)
- Buxtehude (St. Petri)
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- Weitere
- Zugabe
Brachbach
Kath. St. Josef
Orgel Anton Feith (Paderborn), 1939.

Die neugotische Kirche St. Josef in Brachbach war 1871 fertiggestellt. Bei ihrer Weihe 1873 war noch ein Harmonium in Verwendung, das 1874 durch einen Orgelneubau ersetzt wurde. Erbauer und weitere Einzelheiten über dieses Instrument sind nicht bekannt; es handelte sich jedoch um ein Schleifladeninstrument mit 19 Registern auf zwei Manualen und Pedal. Die Prospektgestaltung ließ den Blick auf das Rundfenster mit der Hl. Cäcilia frei.
1939 erfolgte ein Orgelneubau durch die Orgelbaufirma Anton Feith aus Paderborn zum Preis von 12.000 Reichsmark. Die am 12. Februar 1939 geweihte Orgel wurde mit zwei Manualwerken und Pedal ausgestattet und für die spätere Erweiterung um ein drittes Manual vorbereitet (die Registerwippen tragen heute die später hinzugefügten Registernamen: Holzgedeckt 8', Quintade 8', Nachthorn 4', Prinzipal 2', Scharff 3-4f. 1', Gedecktbaß 16').
1966–68 wurde die Kirche anstelle des alten Chorraums um ein neues, großes Kirchenschiff erweitert, wo die Orgel nun ihren Platz auf einer freitragenden Empore an der Stirnseite des Altarraums fand, von wo aus sie den alten wie auch den neuen Teil der Kirche beschallen konnte. Im Zuge rückläufiger Kirchenbesucherzahlen wurde das neue Kirchenschiff allerdings 1993 zur Hälfte als Gemeindehaus abgetrennt; die andere Hälfte dient nun als vergrößerter Chorraum. Auf der vorderen Empore steht heute eine später angeschaffte, kleine Chororgel (Walcker 1979), während die Feith-Hauptorgel 1993 in Eigenleistung der Gemeinde unter Anleitung eines Orgelbauers und des örtlichen Organisten wieder auf die Westempore im Altbau versetzt wurde.
Bei den diversen Versetzungen im Kirchenraum wurde die Orgel auch mehrfach Veränderungen unterzogen, so wurden in beiden Manualwerken ehemalige Achtfuß-Stimmen durch höherliegende Register
ersetzt, der Schwellwer für das zweite Manual wurde stillgelegt und die Prospektgestaltung wurde verändert. Der Mittelteil des mit stummen Pfeifen gebildeten Prospekts verdeckt heute zum Teil das
Cäcilienfenster im Westwerk, während das übrige Pfeifenwerk durch schlichte Sichtschutzwände abgeschirmt ist, in die ebenfalls kleinere Prospektpfeifen integriert wurden. Die Veränderungen im
Laufe der Jahre verliefen nicht unbedingt zum Vorteil der klanglichen und technischen Entwicklung des Instruments; von ihrem Standort seit 1993 kann sie den Kirchenraum nicht ausreichend füllen.
Klanglich hervorzuheben sind die doppelt labiierte Flöte 4' im Hauptwerk und die sanft streichende Zartgeige 8' im Nebenwerk. Im Herbst 2018 wurde die Orgel durch Orgelbau Josef Potthoff
(Bergisch Gladbach) gereinigt und überholt, u. a. wurden die Elektrik und die Klaviaturen erneuert und die Intonation überarbeitet.
Der Spieltisch steht frei links neben der Säule vor der Orgel. Die Verbindung zwischen Spieltisch und Orgel erfolgt über elektrische Trakturen, die Windladen sind als pneumatische Kegelladen
gebaut.
I. HAUPTWERK | C–g³
Bordun 16'
Prinzipal 8'
Oktav 2'
Gedacktpommer 8'
Octav 4'
Flöte 4'
Quinte 2 2/3'
Mixtur 3–4f.
Trompete 8'
Koppel II–I
Subkoppel II–I
Superkoppel II–I
II. NEBENWERK | C–g³
Koppelflöte* 4'
Hohlflöte 8'
Zartgeige 8'
Ital. Prinzipal 4'
Waldflöte 2'
Gemsquinte 1 1/3'
Terz-Cymbel 3f.
Krummhorn 8'
Trem[olo]
* früher: Geigenprinzipal 8'
PEDAL | C–f¹
Subbass 16'
Zartbass 16' [Windabschw.]
Octavbass 8'
Gedeckt-Bass 8'
Gedecktflöte 4'
Posaune 16'
Koppel II–P
Koppel I–P
Ad libitum [= Freie Komb.], Handregister, Tutti, Freie Pedalumschaltung, Crescendo-Walze mit Abstellter, HR ab und Anzeige, Einzelabsteller.
Elektropneumatische Kegellade.
D-57555 Brachbach, Kirchstraße 11
Quellen und Literatur: Franz Bösken, Hermann Fischer und Matthias Thömmes, Quellen und Forschungen zur Orgelgeschichte des Mittelrheins, Bd. 4, Mainz 2005, S. 220–221 ⋄ Frdl. Mitteilung von Thomas Maiworm, 2023 ⋄ Eigener Befund.
Nr. 291 | Diese Orgel habe ich am 10.11.2007 im Rahmen eines Gottesdienstes gespielt.
© Gabriel Isenberg | Letzte Änderung: 24.11.2023.
www.orgelsammlung.de
© Dr. Gabriel Isenberg, 2023/25