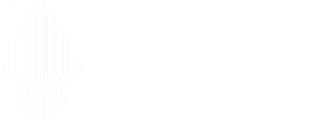- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- Rahrbach (St. Dionysius)
- Ransbach (St. Markus)
- Rath-Heumar (St. Cornelius)
- Rattendorf (St. Andreas und Markus)
- Recklinghausen (St. Elisabeth)
- Rehringhausen (St. Nikolaus)
- Reinhardtsgrimma (ev. Kirche)
- Reisach (St. Petrus und Paulus)
- Reutin (St. Josef)
- Rheda (St. Clemens)
- Rheinhausen-Bergheim (Friedenskirche)
- Rietberg (St. Katharina)
- Ringelheim (St. Abdon und Sennen)
- Rinkenberg (St. Florian)
- Rödgen (ev. Johanneskirche)
- Rödgen (St. Johannes Bapt.)
- Rödgen (Eremitage)
- Rolduc (Abteikirche)
- Rom (Petersdom)
- Ronsdorf (St. Joseph)
- Rüschendorf (St. Agnes)
- Rüttenscheid (St. Ludgerus)
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- Weitere
- Zugabe
Rolduc (Kerkrade)
Abteikirche
Orgel: Johannes Klais (Bonn), 1932, in Zusammenarbeit mit Pereboom & Zonen (Maastricht).

Die Abtei Rolduc (zu deutsch „Klosterrath“) bei Kerkrade in der niederländisch-limburgischen Diözese Roermond nahe der deutschen Grenze ist der größte zusammenhängende Abteikomplex der gesamten Benelux-Länder. Die Gründung des Augustiner-Chorherrenstifts geht zurück auf das Jahr 1104. Wenig später begann der Bau der Abteikirche, deren 1108 vollendete Krypta bis heute existiert. Vor allem im 16. und 17. Jahrhundert erfolgten etliche bauliche Änderungen an der Klosteranlage und in der Klosterkirche. 1796 wurde die Abtei säkularisiert und ihre Grundherrschaft von den Franzosen aufgehoben; die Mönche mussten das Kloster verlassen, das nun mehrere Jahrzehnte leer stand. 1831 wurde das Priesterseminar des Bistums Lüttich in Rolduc eingerichtet, musste aber nur wenige Jahre später wieder ausziehen und kam in Sint-Truiden unter. Daraufhin wurde in Rolduc ein alt- und neusprachliches Jungengymnasium mit angeschlossenem Internat eingerichtet, das einen guten Ruf erlangte. Von 1946 bis 1967 war das Priesterseminar des Bistums Roermond in Rolduc untergebracht. Das Internat des Jungengymnasiums schloss 1970. Das Gymnasium selbst (College Rolduc) fusionierte 2009 mit dem Eijkhagen College aus der angrenzenden Gemeinde Landgraaf zum Charlemagne-College. Und seit 1974 ist in Rolduc das Großseminar des Bistums Roermond ansässig. Die Abteikirche erfuhr Ende des 19. Jahrhunderts größere Renovierungen, und im 20. Jahrhundert wurden in den Jahren 1971 bis 1990 umfassende Restaurierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Abtei Rolduc steht auf der UNESCO-Liste der 100 wichtigsten religiösen Denkmäler der Niederlande.
Die dokumentierte Orgelgeschichte der Abtei setzt im Jahr 1627 ein, als der Orgelmacher Johann Schade aus Münster (offenbar ein Schüler von Johann Busse in Soest) eine zweimanualige Orgel mit 16 Registern baute (ein Jahr später ist er mit dem Bau einer neuen Orgel für den Aachener Dom nachgewiesen). Die Orgel von Schade wurde nach 1750 von dem Aachener Orgelbauer Johann Petrus Hilgers umgebaut und um ein Echowerk erweitert.
Nachdem die Orgel durch die Aufhebung des Klosters mehrere Jahrzehnte nicht genutzt wurde, baute Peter Joseph Korfmacher aus Linnich 1834 eine neue Orgel mit 24 Registern für die Abteikirche. (Die alte Orgel wurde nach Aachen verkauft.) Die Korfmacher-Orgel hatte in Rolduc allerdings nicht lange Bestand, denn mit dem Umzug des Priesterseminars nach Sint-Truiden wurde 1843 auch die Orgel mit dorthin genommen. (In Sint-Truiden zählte man die 1955 durch Flentrop restaurierte Orgel zu den schönsten Orgeln Limburgs, die jedoch leider bei einem Großbrand 1976 zerstört wurde.)
In Rolduc gab es daraufhin zwölf Jahre lang keine Orgel, bis am 16. Juli 1855 ein neues Werk von den Gebr. Müller in Reifferscheid eingeweiht werden konnte. Mit ihrem beeindruckenden historisierenden, von Pierre Cuypers entworfenen Gehäuse, das von mehreren unterhalb der Pfeifenfelder sitzenden Engelsfiguren geschmückt war, setzte die Müller-Orgel einen markanten optischen Akzent im Kirchenraum. Und auch klanglich dürften die 38 Register den Kirchenraum gut ausgefüllt haben. Pläne aus dem Jahr 1902, die Orgel im Kirchenraum zu versetzten, kamen nicht zu Ausführung. Schließlich wurde die inzwischen desolate und nicht mehr „zeitgemäße“ Müller-Orgel 1931 abgerissen und im folgenden Jahr durch die bis heute bestehende Klais-Orgel ersetzt.
Das am 6. März 1932 eingeweihte Instrument ist das Opus 775 der Fa. Johannes Klais in Bonn. Beim Bau arbeitete Klais mit dem Maastrichter Orgelbaubetrieb Michel Pereboom & Zonen zusammen, der vor allem das Pfeifenwerk lieferte. Die orgelbewegte Disposition mit ihren 43 Registern war damals wegweisend für viele weitere Orgelneubauten in den Niederlanden; außerdem baute Klais hier die erste elektrisch traktierte Orgel des Landes. Im Jahr 1968 erfolgte eine Überholung des Instruments durch Pierre Pereboom. Und 1996 restaurierte die Orgelbauwerkstatt Gebr. Vermeulen in Weert die Klais-Orgel.
Das Pfeifenwerk von Pedal und Hauptwerk steht frei an der Rückwand der Westempore, um das Fenster herum angeordnet. Im rechten Emporenbogen steht seitlich das Brustwerk, das Schwellwerk ist in den linken Emporenbogen eingebaut und mit Schwellerjalousien versehen. Der Spieltisch steht frei an der linken Emporenseite vor der Orgel. Für die Superoktavkoppeln ist das Schwellwerk bis a⁴ ausgebaut.
I. HAUPTWERK | C–a³
Bourdon 16’
Principal 8’
Offenflöte 8’
Nachthorngedackt 8’
Dulciana 8’
Praestant 4’
Rohrflöte 4’
Quinte 2 2/3’
Gemshorn 2’
Mixtur 4–6f.
Bombarde 16’
Trompete 8’
Clairon 4’
II-I
III-I
Sub II-I
Sub III-I
Super III-I
Super in I
II. BRUSTWERK | C–a³
Rohrflöte 8’
Gemshorn 8’
Singendprincipal 4’
Blockflöte 4’
Flageolett 2’
Spitzquinte 1 1/3’
Terz 1 3/5’
Krummhorn 8’
Tremolo II
III-II
Sub III-II
Super III-II
Sub in II
III. SCHWELLWERK | C–a³
Liebl. Gedackt 16’
Geigendprincipal 8’
Spitzflöte 8’
Salicional 8’
Vox coelestis 8’
Octave 4’
Traversflöte 4’
Schweizerpfeife 2’
Nachthorn 1’
Sesquialter 2f
Cymbel 4f.
Trompette harm. 8’
Vox humana 8’
Tremolo III
Sub in III
Super in III
PEDAL | C–g¹
Principal 16’
Subbass 16’
Echobass 16’ [WA aus S. 16’]
Quintbass 10 2/3’
Octavbass 8’
Bassflöte 8’
Choralbass 4’
Rauschpfeife 3-4f.
Posaune 16’
I-P
II-P
III-P
Super III-P
Zwei freie Kombinationen, sechs feste Kombinationen und zwei freie Pedalkombinationen, Registercrescendo, Generalabschalter,
Einzelabsteller f. Zungen, Ab- und Einsteller für Koppeln in der Walze, Normal Tutti und General Tutti, Crescendouhr, Voltmeter.
Elektropneumatische Kegellade.
NL-6464 EP Kerkrade | Abdij Rolduc
Quellen und Literatur: Erik van der Heijden, Orgellandschaft zwischen Maas und Rhein, Mettlach 2005, S. 17–19 ⋄ Hans Hilberath, Die Orgelbauer Korfmacher und die
Linnicher Schule, in: Orgellandschaft Rheinland. Bericht über die Jahrestagung 1986 (hrsg. von Franz-Josef Vogt), Kassel 1990, S. 59–138, hier S. 86–88 ⋄ Frans Jespers, Die Orgelbauerfamilie
Müller zur Reifferscheid, Baexem 2011, S. 96 ⋄ Eigener Befund.
Nr. 252 | Diese Orgel habe ich am 05.08.2005 im Rahmen der GdO-Orgeltagung in Maastricht besucht.
© Dr. Gabriel Isenberg | Letzte Änderung: 27.04.2025.
www.orgelsammlung.de
© Dr. Gabriel Isenberg, 2023/25