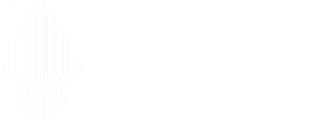Zlan (bei Stockenboi)
Ev. Kirche
Orgel: Jakob Ladstätter (Stockenboi), 1862–64.

In Zlan (Gemeinde Stockenboi, Kärnten) steht die seinerzeit größte evangelische Kirche Kärntens, ab 1806 im „Nachrokoko-Stil“ erbaut, am 2. September 1810 eingeweiht und 1950 mit einem Turm versehen. Kanzel und Altar stammen aus der Villacher Hauptkirche St. Jakob.
Die Zlaner Orgel – ein Werk des Orgelbauers Jakob Ladstätter – ist schon allein in ihrer Größe ein Unikum in der Kärntner Orgellandschaft. Bereits 1826 scheint die erste Orgel in Zlan aufgestellt worden zu sein, zumindest ist das aus den Kirchenrechnungen zu schließen, nach denen in diesem Jahr zum ersten Mal Kalkantengeld gezahlt wurde. 1835 trat Jakob Ladstätter (1804–1875) die Stelle des Lehrers in Zlan an. Er stammte aus Treßdorf im Gailtal und hatte dort bereits bei seinem Vater, dem Landwirt Adam Ladstätter (vulgo Mathel vom Stöfflerberg), Einblick in die Kunst des Orgelbaus bekommen. Sowohl Vater als auch Sohn Ladstätter waren keine ausgebildeten Orgelbauer, sondern hatten sich das Handwerk autodidaktisch angeeignet. Nichtsdestotrotz konnte sich Jakob Ladstätter, der ab 1832 in Stockenboi seine Wohnung und Werkstatt hatte, in den kommenden Jahrzehnten mit etlichen Orgelbauten ein solches Renommee erwerben, dass er ab 1849 auf die Lehrerstelle verzichtete, um sich ganz dem Orgelbau zu widmen.
Auch in Zlan nahm sich Ladstätter der vorhandenen Orgel an (die möglicherweise sogar ein Werk seines Vaters war); belegt sind größere Reparaturarbeiten 1856/57. Offenbar hatte die Gemeinde inzwischen auch den Bau einer größeren Orgel im Blick, denn ab 1861 wurde für die neue Orgel gesammelt. Deren Fertigstellung zog sich bis 1864 hin. Vermutlich war die Orgel ursprünglich nur als zweimanualige Erweiterung der Vorgängerorgel geplant gewesen, von der einiges Material wiederverwendet wurde; und erst im Laufe der Arbeiten wurde das Projekt immer mehr ausgedehnt. Durch den Zubau einer Kombinationslade konnten die zwei Prinzipalregister aus dem Unterwerk (III. Manual) auch im Pedal genutzt werden. Mit ihren schließlich 28 Registern auf vier (!) Manualen und Pedal war die Zlaner Orgel die größte Orgel Kärntens. Die Physhamormonica war vom vierten Manual aus anspielbar und im Spieltisch eingebaut. 1865 erfolgte die farbliche Fassung des Gehäuses. Um die immensen Kosten in Höhe von 1700 Gulden kam es zu Verwerfungen zwischen der Gemeinde und dem Orgelbauer.
1900 erfolgte ein größerer Umbau durch den Orgelbauer Johann Kuher aus St. Leonhard im Loibltal. Er nahm einige kleinere Dispositionsänderungen vor, entfernte die Physharmonica sowie die beiden Pedalzungen Posaune 16' und Trompete 8' und baute eine neue Windanlage mit großem Magazinbalg und Schöpfern im Untergehäuse. 1955 schrieb der Orgelforscher Oskar Eberstaller über die Orgel: „Die Disposition ist zwar eigenartig, aber nicht befriedigend, auch die Intonation läßt viel zu wünschen übrig; auch soll die Orgel nicht besonders gut funktioniert haben, so daß Ladstätter mancherlei Anfeindungen ausgesetzt war und sich schließlich auf seinen Besitz in Stockenboi zurückzog.“
Die Wiener Orgelbaufirma Herbert Gollini führte 1984/85 Restaurierungsarbeiten durch, ohne jedoch die Änderungen von 1900 rückgängig zu machen. Dabei wurde u. a. der Spieltisch neu gestaltet, der Pedalumfang erweitert (ursprünglich C–cº) und das zweite mit dem dritten Manual vertauscht.
Der Spieltisch steht frei vor der Orgel, der Organist blickt ins Kirchenschiff. Die Register werden über eiserne Hebel eingeschaltet, die links und rechts senkrecht aus dem Spieltischgehäuse ragen. Die Logik der Registerhebel-Anordnung ist nicht auf den ersten Blick zu erschließen.
Die drei Manualwerke sind alle mit ähnlichen Klangfarben besetzt – ein etwas ungewöhnliches Dispositionskonzept, das aber in der Genese des Instruments begründet ist und dessen Eigenart ausmacht. Vom Charakter her ist das II. Manual das Hauptwerk, allerdings klingt es (zumindest vom Spieltisch aus) recht weit entfernt; und alle Manualwerke sind auf das I. Manual koppelbar, das damit faktisch die Funktion des Hauptwerks übernimmt. Das III. Manual ist ein klassisches „Nebenwerk“ mit Begleitcharakter, wofür wiederum der Prinzipal 16' sehr untypisch ist. Der insgesamt schöne Klang der Orgel bietet vor allem im Grundstimmenbereich einige ansprechende Farben.
Im Sommer 2024 wurde die Orgelbauwerkstatt Klais (Bonn) mit einer umfassenden Restaurierung dieses einmaligen Instruments beauftragt. Im Rahmen eines ORF-Fernsehgottesdiensts am 31. August 2025 konnte die grunderneuerte und auf den Ursprungszustand zurück versetzte Ladstätter-Orgel wieder eingeweiht werden. Zusätzlich zu den rekonstruierten Zungen wurden auch zwei Register (Violine 8' und Violnbass 16') von 1900 übernommen. Zum Einweihungstermin waren 17 von 28 Registern fertiggestellt, die Vervollständigung ist für den 1. November 2025 geplant.
Disposition 1985–2024:
I. MANUAL | C–f³
Prinzipal 8'
Hohlflöte 8'
Gambe 8' [1900]
Oktave 4'
Flöte 4'
Quinte 2 2/3'
Superoktave 2'
Rauschquinte 2f. [1985]
Koppel III–I
Koppel II–I
II. MANUAL | C–f³
Bordun 16'
Praestant 8'
Flöte 8'
Gedeckt 8'
Salicional 8' [1900]
Flöte 4'
Gemshorn 4'
Quinte 2 2/3'
Oktave 2'
Mixtur 3f.
III. MANUAL | C–f³
Prinzipal 16'
Oktave 8'
Violine 8' [1900]
Flöte 4'
Kornett 4f.
PEDAL | C–d¹
Prinzipalbaß 16' [Tr. III]
Subbaß 16'
Violon 16' [1900]
Oktavbaß 8' [Tr III]
Koppel III–P
Koppel II–P
Koppel I–P
Mechanische Schleiflade.
Original-Disposition ab 2025:
Angaben folgen
A-9713 Zlan | Kirchplatz 14
Quellen und Literatur: Oskar Eberstaller, Orgeln und Orgelbauer in Österreich, Graz-Köln 1955, S. 135 ⋄ Broschüre „Kirchenorgeln. Kärnten. Slowenien. Friaul“ (Hrsg. von Kath. Kirche Kärnten), S. 43 ⋄ Gottfried Allmer, Die Ladstätter-Orgel der evangelischen Pfarrkirche Zlan in Kärnten, in: Principal 21 (2018), S. 25–28 ⋄ Pressemeldungen zur Orgelrestaurierung 2022–25 ⋄ Frdl. Mitteilung von Mag. Matthias Krampe, 02.09.2025 ⋄ Eigener Befund.
Nr. 218 | Diese Orgel habe ich am 24.08.2004 im Rahmen meiner Kärnten-Orgelforschungs-Reise besucht.
© Dr. Gabriel Isenberg | Letzte Änderung: 03.09.2025.
www.orgelsammlung.de
© Dr. Gabriel Isenberg, 2023/25