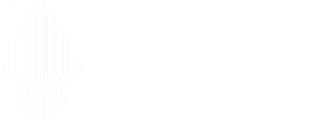- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- Kaan-Marienborn (St. Bonifatius)
- Kaan-Marienborn (ev. Kirche)
- Karlshorst (Zur frohen Botschaft)
- Karlsruhe (St. Stephan)
- Karnap (St. Marien, ehem.)
- Kattenvenne (ev. Kirche)
- Katzenfurt (ev. Kirche)
- Kellinghausen (St. Maria Magdalena)
- Kempen (Propsteikirche)
- Kempen (Paterskirche)
- Kempen (Thomaskirche)
- Kempen (Christ König)
- Kenz (St. Marien)
- Kerschdorf (St. Ulrich)
- Kevelaer (Kerzenkapelle)
- Kirchbach (St. Martin)
- Kirchen (St. Michael)
- Kirchhundem (St. Peter und Paul, Barockorgel)
- Kirchhundem (St. Peter und Paul. große Orgel)
- Klagenfurt (St. Egid)
- Kleve (St. Mariä Himmelfahrt)
- Kohlhagen (Wallfahrtskirche)
- Köln (St. Peter)
- Kraków (Sanktuarium Św. Jana Pawła II)
- Krassnitz (St. Martin)
- Kreuztal (Kreuzkirche)
- Kreuztal (Bonhoeffer-Haus, ehem.)
- Kreuztal (St. Johannes Bapt.)
- Kreuztal (St. Johannes Bapt., Interimsorgel)
- Kreuztal (Christus Erlöser)
- Kreuztal (Friedhofskapelle)
- Krombach (St. Ludger und Hedwig)
- Kückelheim (Erlöserkirche)
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- Weitere
- Zugabe
Kohlhagen, Wallfahrtskirche Mariae Heimsuchung
Orgel von Johann Henrich Kleine (Eckenhagen), 1745.

Im Jahr 1490 wurde erstmals eine Kapelle „auf dem Berge unser Lieben Frauen“ bei Brachthausen bezeugt. Die heutige, nachgotische Kirche wurde 1703/07 um den Vorgängerbau herum errichtet: ein auf quadratischem Grundriss abgesetzter Turm mit Spitzhelm (seit etwa 1809) im Westen, dem Langhaus und der eingeschnürten Chorapsis. Bedeutend ist der Hochaltar des Attendorner Künstlers Peter Sasse (um 1709).
Die Orgel der Wallfahrtskirche wurde (auf Initiative des am 25. Juni 1745 verstorbenen Pfarrers Paulus Leyeman) laut einer Inschrift im Jahr 1745 zusammen mit der Empore erbaut. Auf einem Balken
im Innern des Instruments findet sich allerdings die eingeschnitzte Zahl 1709. Möglicherweise ist dies ein Hinweis auf ein älteres Vorgängerinstrument, dessen Bestandteile 1745 wiederverwendet
wurden. Bei der jüngsten Reinigung 2016 dokumentierte der Orgelbauer Udo Feopentow (Wienhausen b. Celle) auf einer Pfeife die eingravierte Jahreszahl 1741 und datierte weitere einzelne Pfeifen
auf die Zeit um 1680.
Wenngleich es keine Bauakten zur Orgel gibt, aus denen der Name des Orgelbauers von 1745 hervorgehen könnte, gilt die Zuschreibung an den Eckenhagener Orgelbaumeister Johann Henrich Kleine heute
als gesichert. Dass der Spieltisch ursprünglich in die Rückwand der Orgel eingebaut war, bezeugen zwei Sehschlitze, die durch das Untergehäuse führen, sowe die erhaltenen sechzehn Registerlöcher
in der Rückwand.
Das Gehäuse wurde 1825 durch zwei seitliche Flachfelder von je drei Pfeifen erweitert, um den originalen Klaviaturumfang von 48 Tönen (C, D – c³) auf 54 Töne (C – f³) erweitern zu können. Die
Putten unter den Spitztürmen zeigen den Verlauf der originalen Auskragung des Obergehäuses an. In Verbindung mit diesem Umbau wurde wohl auch die Spielanlage an die nördliche Schmalseite verlegt.
Die Arbeiten führte Gerhard Nohl (Allinghausen) auf der Grundlage eines Kostenangebots von Christian Roetzel (Alpe) durch. Im 19. Jahrhundert sind mehrfache kleinere Reparaturarbeiten belegt.
Vorschläge zur Erweiterung auf zwei Manuale, wie sie Adam Fischer (Hirschberg) 1882 und Fritz Klingenhegel (Münster) 1946 vorlegten, kamen nicht zur Ausführung.
Nach wenig zufriedenstellenden Renovierungsmaßnahmen 1952 durch Rudolf Mendel aus Brilon wurde die Orgel 1980/81 durch Siegfried Sauer in Höxter-Ottbergen restauriert (Wiedereinweihung am 17. Mai
1981). Die Windlade von 1745, die Zusatzlade und die Spielanlage von 1825 sowie der wesentliche Bestand von Pfeifenwerk, Balganlage und Gehäuse sind erhalten, womit die Kohlhagener Orgeln zu den
herausragenden Dokumenten des spätbarocken Orgelbaus im südlichen Sauerland zählt. Zuletzt führte der Orgelbauer Udo Feopentow (Wienhausen b. Celle) 2016 eine Reinigung und Überholung durch.
MANUAL | C–f³
Bordun 16' [ab A]
Prinzipal 8'
Gedackt Bass 8' [bis fisº]
Gedackt Disk. 8' [ab gº]
Waldflöte 8' [ab gº]
Salizional 8' [ab gº]
Oktave 4'
Gedacktflöte 4'
Quinte 2 2/3'
Oktave 2'
Flöte 2'
Quinte 1 1/3'
Kornett 3f. 2 2/3 [ab c¹]
Mixtur 3f. 1'
Trompete 8'
(Vakantschleife)
PEDAL | C–fº
angehängt
Mechanische Schleiflade.
D-57399 Kirchhundem-Brachthausen | Kohlhagen
Quellen und Literatur (Auswahl): Pfarrarchiv Brachthausen-Kohlhagen, Orgelakten ⋄ Gabriel Isenberg, Orgellandschaft im Wandel, Phil. Diss., Dresden 2017, S. 93–96 ⋄ Hans Thiel, 500 Jahre Wallfahrtskirche Kohlhagen. Beiträge zur Geschichte und Gegenwart, Kohlhagen 1990 ⋄ Eigener Befund.
Nr. 6 | Diese Orgel habe ich zum ersten Mal am 18.04.1995 gespielt, danach mehrfach bei Gottesdiensten und Konzerten.
© Dr. Gabriel Isenberg | Letzte Änderung: 01.01.2025.
www.orgelsammlung.de
© Dr. Gabriel Isenberg, 2023/25