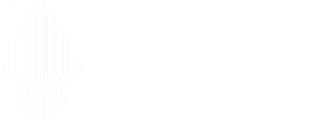Charlottenburg, Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
Orgel von Karl Schuke (Berlin), 1962.

Für die erste, 1890 bis 1895 nach Plänen von Franz Schwechtern im neogotischen Stil errichtete Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Berliner Kurfürstendamm baute Wilhelm Sauer aus Frankfurt/Oder 1895 eine große Orgel mit vier Manualen und 91 Registern auf pneumatischen Kegelladen. 1920 fügte Sauer ein Echowerk hinzu, so dass das Instrument nun über 103 Register verfügte. 1938 erfolgte eine Instandsetzung durch die Fa. Sauer. Doch am 22. November 1943 wurden Kirche und Orgel im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs komplett zerstört.
Bereits wenige Monate nach Kriegsende fanden wieder Gottesdienste in der Ruine statt; ihr Symbolwert für das Nachkriegs-Berlin und den Wiederaufbauwillen wuchs schnell. Und so entschloss man sich bald für den Bau einer neuen Gedächtnis-Kirche. Die eindrucksvolle Turmruine blieb erhalten, neben ihr wurde nach dem Entwurf des Architekten Egon Eiermann 1960/61 ein neuer, achteckiger Kirchbau errichtet – seitdem eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Berlins. Beim Neubau der Kirche arbeiteten Architekt und Orgelbauer zusammen, und so entwarf Eiermann auch die Grundstruktur des asymmetrisch angelegten Orgelprospekts. Als die für den Orgelneubau verantwortliche Firma beauftragte man die Berliner Orgelbauwerkstatt Karl Schuke, die 1962 einen für die relativ geringe Kirchenraum-Größe üppigen Orgelneubau mit 64 Registern auf vier Manualen und Pedal ausführte. Prof. Siegfried Reda (Essen) entwarf die farbige und obertonreiche Disposition. Der Prospekt spiegelt streng den Werkaufbau des Inneren wider. Die Spielanlage befindet sich im Orgelfuß und wurde ebenfalls maßgeblich durch Eiermann mitgestalte; sie ist durch ein Gitter optisch vom Kirchenraum abgesetzt.
Bereits 1967 gab es Versuche, die stumpfe Akustik der Kirche durch Veränderungen an der Außenwandstruktur zu verbessern. In Verbindung mit dieser Veränderung wurde die Orgel 1968 durch Karl Schuke gereinigt und die Koppeln wurden elektrifiziert. 1978 führte Schuke eine Reparatur durch und sieben Jahre später (1985) änderte er die Disposition. 1986 wurde durch die Fa. Schuke eine neue Setzeranlage mit elektro-optischen Koppeln eingebaut und 1988 wurden die Spanischen Trompeten (übrigens auf Anregung von Eiermann eingebaut) aufgearbeitet und neu intoniert. Eine erneute Überholung erfolgte Anfang 2005. Dabei wurden die Motoren, Klaviaturen und Trakturen erneuert. Außerdem vertauschte man die Manualbelegung von III. und IV. Manual (ursprünglich wurde das Schwellwerk vom IV. Manual aus angespielt). Im Schwellwerk gibt es nun die beiden Schwebungsregister Viole de Gambe und Voix céleste anstelle von Unda maris 8’ und Spitzgambe 4’.
2017 erhielt die Orgel eine neue Setzeranlage mit MIDI-Ausstattung; dadurch ergibt sich die Möglichkeit frei programmierbarer Koppeln und von Registerauszügen in allen Fußtonlagen, außerdem eine Fernsteuerung über WLAN und MIDI-LAN-Verbindung. Um der Orgel im tiefen Frequenzspektrum mehr Gewicht zu verleihen, erfolgte 2018 die Erweiterung zu einer Hybridorgel: Die Disposition wude um 32 digitale Register erweitert; über acht hinter Orgel installierte Basslautsprecher steht auf elektronischem Wege ein labiales 32'-Register zur Verfügung. Dieser Schritt erzeugte allgemein Aufmerksamkeit in der Orgelwelt, war aber unter anderem darin begründet, dass die Orgel aus Denkmalschutzgründen nicht mit weiteren Registern, und vor allem nicht mit „echten“ labialen 32'-Pfeifen ausgestattet werden konnte.
Untenstehend sind die digital hinzugefügten Register mit ● gekennzeichnet; sie sind im Spieltisch über ein neues, optisch angepasstes Tableau oberhalb des original belassenen Registertableaus schaltbar. Die elektronische Steuerung der Setzeranlage und der frei programmierbaren Koppeln und Registerauszüge (Fa. Laukhuff) ist über ein Touchdisplay zu bedienen, das in einer Schublade rechts neben dem Klaviaturblock untergebracht ist.
I. POSITIV | C–g³
Prinzipal 8'
Rohrflöte 8’
● Flûte à cheminée
Quintadena 8’
● Gemshorn 8'
● Gemshorn céleste 8'
Oktave 4’
Blockflöte 4’
● Koppelflöte 4'
Rohrpfeife 2’
Quinte 1 1/3’
Sesquialtera 2f. 2 2/3’
Mixtur 4–6f. 1 1/3’
Terzcymbel 3f. 1/4’
Fagott 16’
● Tuba magna 16'
● Trompete 8'
● Corno di Bassetto 8'
Oboe 8’
Schalmei 4’
Tremulant
Koppel III–I
[Koppel III–I 16']
[Koppel III–I 4']
II. HAUPTWERK | C–g³
Prinzipal 16’
● Montre 16'
Oktave 8’
● Montre 8'
● Flûte harmonique 8'
Spielflöte 8’
Oktave 4’
● Flûte octaviante 4'
Nachthorn 4’
Rohrnassat 2 2/3’
Oktave 2’
Mixtur I 6–8f. 2’
Mixtur II 4f. 1’
Trompete 16’
Trompete 8’
Sp. Trompete 8’
Sp. Trompete 4’
Koppel IV–II
Koppel III–II
[Koppel III–II 16']
[Koppel III–II 4']
Koppel I–II
III. SCHWELLWERK | C–g³
● Bourdon 16'
Ged. Pommer 16’
● Montre 8'
Schwegel 8’
● Flûte harmonique 8'
Koppelflöte 8’
Viole de Gambe 8’ [2005]
● Gambe 8'
Voix céleste 8’ [2005]
● Octave 4'
Holzprinzipal 4’
● Flûte octaviante 4'
Hohlquinte 2 2/3’
Nachthorn 2’
Terz 1 3/5’
Gemshorn 1’
Cornettzug [= Sammelzug]
Fourniture 5–7f. 2’
Rauschpfeife 2f. 1 1/3’
● Bombarde 16'
Trompette harm. 8’
● Hautbois 8'
● Clarinette 8'
● Voix humaine 8'
Clairon 4’
Tremulant
Koppel IV–III
Koppel III 16'
Koppel III 4'
IV. BRUSTWERK (SW) | C–g³
Holzgedackt 8’
Spitzgedackt 4’
Prinzipal 2’
Oktave 1’ [1985]
Terzian 2f. 1 3/5’
Scharff 3–5f. 1/2’
Vox humana 8’ [1991]
Krummhorn 8’
Tremulant
PEDAL | C–f¹
● Subbass 32'
● Contrebasse 32'
Prinzipal 16’
Subbaß 16’
● Zartbass 16'
● Violone 16'
● Contregambe 16'
● Salicetbass 16'
Quinte 10 2/3’
● Diapason 8'
Oktave 8’
Gedackt 8’ [1985]
● Cello 8'
Oktave 4’
Hohlflöte 4’
Feldpfeife 1’
Baßsesquialt. 5 1/3’ 3 1/5’ 2 2/7’
Mixtur 3f. 2 2/3’
● Contrebombarde 32'
Fagott 32’
● Bombarde 16'
Posaune 16’
● Fagott 16'
Trompete 8’
Sp. Trompete 4’
Sp. Cornett 2’
Koppel IV–P
Koppel III–P
Koppel II–P
Koppel I–P
Elektronische Setzeranlage, MIDI-Anschluss, frei programmierbare Koppeln und Registerauszüge.
Schleiflade, mechanische Spieltraktur MIDIfiziert, elektrische Registertraktur.
D-10789 Berlin-Charlottenburg | Breitscheidplatz
Quellen und Literatur: Berthold Schwarz (Hrsg.), 500 Jahre Orgeln in Berliner evangelischen Kirchen, S. 379-383, 455 (Bd. 2) ⋄ Flyer „Karl-Schuke-Orgel Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche Berlin“ [2020] ⋄ Eigener Befund.
Nr. 77 | Diese Orgel habe ich zum ersten Mal am 20.10.1999 gespielt.
© Dr. Gabriel Isenberg | Letzte Änderung: 24.09.2023.
www.orgelsammlung.de
© Dr. Gabriel Isenberg, 2023/25