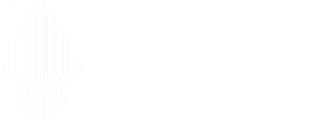- A
- B
- C
- D
- E
- F
- Falkenberg (St. Maria Königin)
- Fedderwarden (St. Stephanus)
- Fedderwardergroden (Friedenskirche)
- Feistritz/Gail (St. Martin)
- Fellinghausen (Friedenskirche)
- Ferndorf (ev. Laurentiuskirche)
- Ferndorf (Hausorgel Busch)
- Feudingherhütte (kath.-apostol. Kirche)
- Fischelbach (ev. Kirche)
- Fladderlohausen (Christuskirche)
- Fleckenberg (St. Antonius)
- Förolach (St. Jakobus d. Ä.)
- Freiburg (Adelhauser Kirche)
- Fretter (St. Matthias)
- Freudenberg (St. Marien)
- Fritzendorf (St. Chrysanthus)
- Füssen (St. Mang)
- Füssen (St. Mang, Chororgel)
- Füssen (St. Sebastian)
- Füssen (ULF am Berg)
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- Weitere
- Zugabe
Fleckenberg, St. Antonius
Orgel von Adolph Ibach & Söhne (Barmen), 1865.

Die 1905/07 erbaute und 1911 konsekrierte St.-Antonius-Kirche in Fleckenberg bei Schmallenberg verfügt über ein besonderes Orgel-Denkmal: die größte erhaltene Ibach-Orgel und zugleich eine von nur zwei erhaltenen (ehemaligen) historischen Synagogen-Orgeln in Deutschland.
Die Werkstatt für Klavier- und Orgelbau Adolph Ibach & Söhne in Barmen (Inh. Rudolf Ibach) hatte 1865 für die Synagoge in Aachen ein Instrument mit 24 Registern auf zwei Manualen und Pedal erbaut. Vierzig Jahre lang tat diese Orgel der Aachener jüdischen Gemeinde ihren Dienst, bis 1905 eine neue Orgel des Orgelbauers Eduard Stahlhuth für die Synagoge angeschafft werden sollte. So wurde die Ibach-Orgel von Stahlhuth in Aachen ausgebaut und von Ernst Tennstädt (Lippstadt) 1906 ohne den ursprünglichen Prospekt in der Fleckenberger St.-Antonius-Pfarrkirche wieder aufgestellt.
Bis 1955 wurden an der Orgel in Fleckenberg keinerlei Veränderungen vorgenommen. Nur knapp entging sie einem Neubau, den der Sachverständige Rudolf Reuter verhindern konnte. Die Ibach-Orgel wurde daraufhin in den Jahren 1955/58 durch die Werkstatt Franz Breil (Dorsten) überholt, wobei sie auch einen neuen, schlichten Prospekt erhielt. Die Disposition wurde „aufgehellt“.
Ein erneuter Umbau erfolgte 1970 durch die Orgelbauwerkstatt Gebr. Stockmann in Werl, der allerdings ohne Kenntnis und Zustimmung des Amts für Denkmalpflege durchgeführt wurde. Dabei wurde ein neuer Spieltisch mit elektrischer Registertraktur eingebaut.
Nach weiteren Jahren des Verfalls und Befalls durch Holzschädlinge erkannte der Domorganist und Sachverständige Helmut Peters (Paderborn) dringenden Handlungsbedarf, um das wertvolle Instrument zu bewahren. Mehrere Versuche, die Fleckenberger Orgel für ein jüdisches Kulturzentrum in Deutschland wiederzugewinnen, auch eine Anfrage zur Aufstellung des Instruments im Konzertsaal der Universität in Tel Aviv zerschlugen sich später.
So blieb die Ibach-Orgel der Fleckenberger Kirche erhalten und konnte durch die Osnabrücker Werkstatt Joachim Kreienbrink 1998–2000 grundlegend restauriert werden. Dabei wurde eine weitestgehende Rückführung auf den Originalzustand von 1865 angestrebt, wobei auch Kompromisse an die heutigen Anforderungen gemacht wurden. Nach den Vorbildern anderer erhaltener Bestandteile von Ibach-Orgeln (v. a. in Deventer, Parochialkirche) wurden fehlende Teile sowie das Gehäuse möglichst originalgetreu rekonstruiert. Am Palmsonntag, den 16. April 2000 fand die Weihe der restaurierten Ibach-Orgel statt.
Der Spieltisch wurde nach Ibachschem Vorbild von Kreienbrink neu angefertigt. Er befindet sich an der rechten Seite des Orgelgehäuses. Um das Notenpult herum sind die Registerzüge angeordnet: links für das Unterwerk, oben für Hauptwerk und rechts für Pedal und Koppeln.
I. UNTERWERK | C–f³
Salicional 8'
Fernflöte 8'
Gedackt 8'
Quintatön 8'
Fugara 4'
Flaut dois 4'
Flageolet 2'
Fagott/Hautbois 8'
II. HAUPTWERK | C–f³
Principal 8'
Bordun 16'
Flaut major 8'
Viola di Gamba 8'
Octav 4'
Spitzflöte 4'
Quinte 2 2/3'
Superoctav 2'
Cornett 4f. [4']
Mixtur 4f. (2']
Trompete 8'
Manualkoppel
PEDAL | C–d¹
Violon 16'
Subbass 16'
Principal 8'
Violoncello 8'
Gedackt 8'
Posaune 16'
Koppel II–P
Koppel I–P
Mechanische Schleiflade.
D-57392 Schmallenberg-Fleckenberg | Latroper Straße 22
Quellen und Literatur: Festschrift zur Einweihung der restaurierten Ibach-Orgel in der Pfarrkirche St. Antonius zu Fleckenberg, Fleckenberg 2000 ⋄ Eigener Befund.
Nr. 111 | Diese Orgel habe ich am 13.09.2000 gespielt.
© Dr. Gabriel Isenberg | Letzte Änderung: 28.02.2023.
www.orgelsammlung.de
© Dr. Gabriel Isenberg, 2023/25