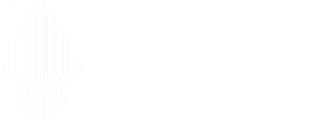- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- Garrel (St. Peter und Paul)
- Gehrde (St. Christophorus)
- Geisweid (St. Marien)
- Gescher (St. Pankratius)
- Glandorf (St. Johannis)
- Gleidorf (Herz Jesu)
- Göteborg (Christinae kyrka)
- Göteborg (Kristus Konungen)
- Grombühl (St. Josef)
- Gronau (St. Matthäi)
- Großhansdorf (Hl. Geist)
- Grüne (Herz Jesu, ehem.)
- Grunewald (St. Apollinaris)
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- Weitere
- Zugabe
Göteborg
Evangelisch-lutherische Örgryte Nya Kyrka
Örgryte Kyrkogata • S-41274 Göteborg
Kirche
Die alte Kirche im Göteborger Bezirk Örgryte wurde im 19. Jahrhundert zu klein für die stark wachsende Gemeinde. So wurde die neogotische Neue Örgryte-Kirche nach den Plänen des Architekten Adrian C Peterson erbaut und am 6. Juli 1890 eingeweiht. Als Vorbereitung zum Bau der Barockorgel-Rekonstruktion wurde die Kirche in den Jahren 1996-97 sorgfältig restauriert.
Norddeutsche Orgel

Die erste Orgel in der Örgryte Nya Kyrka errichtete die Göteborger Orgelbauwerkstatt Salomon Molander & Co. Das Instrument wurde zusammen mit dem Kirchbau fertiggestellt.
Die Molander-Orgel wurde 1922 durch den Neubau op. 1998 von E. F. Walcker (Ludwigsburg) mit 48 Registern auf drei Manualen und Pedal ersetzt. Dieses Instrument blieb nur wenige Jahre in seiner Form bestehen: Nach den Vorstellungen des damaligen Organisten errichtete die Firma Anders Mårtensson (Lund) 1939 eine neue Orgel, die von der Orgelbewegung beeinflusst war. Einige Register aus der Walcker-Orgel wurden wiederverwendet.
Anfang der 1990er Jahre wurden das Göteborg Organ Art Center (GOArt) in Zusammenarbeit mit der Universität Göteburg auf die Örgryte Nya Kyrka aufmerksam, da sie einen geeigneten Kirchenraum für die Rekonstruktion einer großen norddeutschen Barockorgel als Forschungsprojekt suchten, den sie in der Neuen Örgryte-Kirche fanden. Ziel des Projekts war die Wiederentdeckung von Arbeitsweisen und Gestaltungsformen des norddeutschen Orgelbauers Arp Schnitger (1648-1719). Wenngleich das neue Instrument dem Stil eines einzelnen Orgelbauers vepflichtet sein sollte, dienten doch mehrere Instrumente Schnitgers als Vorbild, da keine Schnitger-Orgel der geplanten Größe als Vorbild originalgetreu erhalten war.
Die Ausführung der Arbeiten lag in den Händen mehrer internationaler Orgelbauer: Henk van Eeken (Herwijnen, Niederlande) war verantwortlich für Entwürfe und technische Zeichnungen, der Japaner Munetaka Yokota für das Pfeifenwerk (Forschung, Bau und Intonation) und Mats Arvidsson (Stallarholmen, Schweden) beaufsichtigte den Bauprozess. Der Orgelbau wurde in der eigens dazu eingerichteten Orgelforschungswerkstatt der Universität Göteborg gebaut. Das ganze Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Chalmers in Göteborg durchgeführt und sowohl durch staatliche Mittel, als auch durch Forschungsstiftungen – v. a. die Stiftung Riksbankens Jubileumsfond – und der schwedischen Handelsbank finanziert. Alle Aktivitäten wurden im GOArt unter der Projektleitung von Hans Davidsson gebündelt.
Die Gestaltung der Orgel ist das Ergebnis der Studie mehrerer historischer Orgeln. Pfeifenwerk und Disposition basieren hauptsächlich auf der Schnitger-Orgel in Hamburg St. Jacobi, in der sich auch Pfeifenmaterial von Scherer und Fritzsche befindet. Die Manualwindladen dieser Orgel konnten ebenfalls als Konstruktionsvorlage benutzt werden – erweitert um die Einrichtung der Subsemitonien. Die Pfeifen wurden nach dem alten Sandgussverfahren gefertigt.
Gehäuse und Spielanlage sind an der Orgel des Lübecker Doms orientiert. Der 1942 durch Kriegseinwirkung zerstörte Prospekt von 1699 – im typisch norddeutschen Werkaufbau – wurde anhand von Fotografien, Zeichnungen und Messergebnissen vom Beginn des 20. Jahrhunderts maßstabsgetreu rekonstruiert.
Die Balganlage mit 12 Keilbälgen im oberen Turmzimmer (sowohl elektrisch als auch per pedes zu bedienen) wurde nach der Orgel in der Grote Kerk Zwolle entwickelt, während der Bau der Trakturen sich nach der Orgel der Laurenskerk in Alkmaar richtet.
Um die Orgel dem Klang der Barockzeit anzunähern, wurden die alten Handwerksmethoden rekonstruiert und angewendet. Alle Forschungsergebnisse wurden parallel zum Bau dokumentiert und publiziert.
Die Örgryter Orgel ist in der terzenreinen mitteltönigen Stimmung gestimmt, die Schnitger wahrscheinlich bei den meisten seiner Instrumente angewandt hat. Um das verwendbare Tonartenspektrum zu erweitern, wurden einige doppelte Obertasten – sog. Subsemitonien – gebaut. In den Werken befinden sich pro Oktave zwei Subsemitonien pro Oktave (es/dis und gis/as). Im Rückpositiv befinden sich nach dem Modell der Hamburger Jacobiorgel zu Zeiten Matthias Weckmanns in der Mitte des 17. Jahrhunderts drei Subsemitonien. Die Registerzüge befinden sich links und rechts neben der Spielanlage. Werden die Sperrventile (auf der rechten Seite) gezogen, sind die Manuale „eingeschaltet“. Die beiden Manualkoppeln sind als Schiebekoppeln gebaut.
Die Orgelweihe der norddeutschen Orgel fand am 12. August 2000 statt. Dieses herausragende Instrument mit seinen fast 4000 Pfeifen ist die größte existierende Orgel in mitteltöniger Stimmung und sowohl ein organologisch äußert bedeutendes Experiment wie auch ein musikalisch sehr überzeugendes Medium für die adäquate Wiedergabe der nordeuropäischen Barockmusik.
I. RückPositiv CDE – c³
Principal 8f
Quintadena 8f
Gedact 8f
Octav 4f
Blockfloit 4f
Octav 2f
Quer Floit 2f
Sieffloit 11/2f
Sexquialt [2fach]
Scharff [6.7.8fach]
Dulcian 16f
Bahrpfeiff 8f
Tremulant
II. Werck CDEFGA – c³
Principal 16f
Quintaden 16f
Octav 8f
Spitzfloit 8f
Octav 4f
Super Octav 2f
Rauschpfeiff [2fach]
Mixtur [6.7.8fach]
Trommet 16f
OP/W
BP/W
III. OberPos. CDEFGA – c³
Principal 8f
Hollfloit 8f
Rohrfloit 8f
Spitzfloit 4f
Octav 4f
Nasat 3f
Gemshorn 2f
Octav 2f
Scharff [6fach]
Cimbel [3fach]
Trommet 8f
Vox Humana 8f
Zincke [ab fº] 8f
Tremulant
IV. BrustPos. CDEFGA–c³
Principal 8f
Octav 4f
Hollfloit 4f
Waltfloit 2f
Sexquialter [2fach]
Scharff [4.5.6fach]
Dlucian 8f
Trechter Regal 8f
Pedal CD – d¹
Principal 16f
SubBass 16f
Octav 8f
Octav 4f
Rauschpfeiffe [3fach]
Mixtur [6.7.8fach]
Posaunen [ab F] 32f
Posaunen 16f
Dulcian 16f
Trommet 8f
Trommet 4f
Cornet 2f
Tremulant
Nebenregister
Cimbelstern
Vogelgesang
Trommel
Nonsens
Sperrventiele: W, RP, OP, BP, Ped., HauptVentiel
Subsemitonien:
- alle Manuale: esº/disº, gisº/asº, es¹/dis¹, gis¹/as¹, es²/dis²
- im RP außerdem: bº/aisº, b¹/ais¹, gis²/as²
- Pedal: esº/disº, gisº/asº
Literatur
Joel Speerstra (Hg.), The North German Organ Research Project at Göteborg University, Göteborg 2003
© Gabriel Isenberg, 2010
www.orgelsammlung.de
© Dr. Gabriel Isenberg, 2023/25